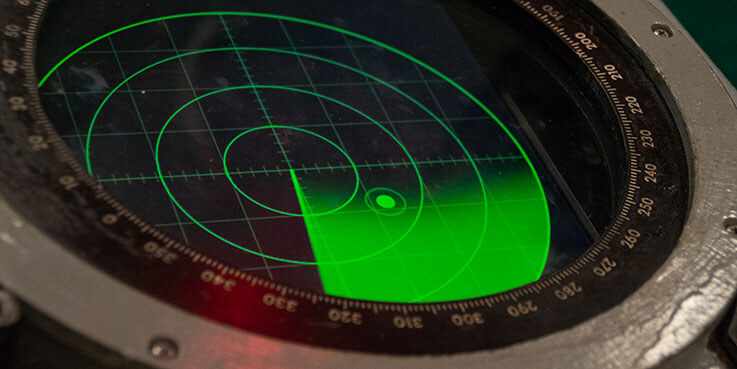In Zusammenarbeit mit Kanzlei Föhlisch
In Zusammenarbeit mit Kanzlei Föhlisch
OLG Köln: Fliegender Gerichtsstand nach Anti-Abmahngesetz weiter möglich

Seit dem 2.12.2020 bereits gilt das sog. Anti-Abmahngesetz, das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, das auch den fliegenden Gerichtsstand bei Verstößen einschränkt, die in Telemedien oder im elektronischen Geschäftsverkehr begangen werden. Die Auslegung beschäftigt die Gerichte jedoch weiterhin. Das OLG Köln (Urt. v. 5.9.2025 – 6 W 53/25) entschied nun, dass die Beschränkung des fliegenden Gerichtsstands gem. § 14 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG einschränkend auszulegen sei.
Die Beteiligten streiten um die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der Bewerbung von Matratzen. Die Antragstellerin begehrt im Wege einer einstweiligen Verfügung von der Antragsgegnerin die Unterlassung der Bewerbung eines Matratzentyps als „orthopädisch“. Streitig ist die Frage, ob diese Werbung gegen § 5, § 5a UWG, § 3a UWG sowie § 3 Nr. 1 HWG verstößt. Der Anbieter betreibt einen Onlinevertrieb. Das erstinstanzlich zuständige LG Köln hatte mit Beschluss vom 26.6.2025 die örtliche Zuständigkeit verneint; daraufhin wurde bei dem Oberlandesgericht Köln Beschwerde eingelegt.
Das OLG Köln entschied nun, dass das LG Köln seine örtliche Zuständigkeit zu Unrecht verneint habe. § 14 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG sei einschränkend auszulegen. Ob diese Einschränkung nur für Fälle gilt, in denen nicht von einer besonderen Gefahr des Missbrauchs in Form eines massenhaften Vorgehens auszugehen ist, oder nur für im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangene Verstöße gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten, konnte das Gericht offenlassen.
Auslegung umstritten
Das OLG Köln stellte zunächst klar, dass die Auslegung des § 14 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG in Literatur und Rechtsprechung umstritten sei.
Es ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten, ob und wie die in § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG enthaltene Begrenzung des "fliegenden Gerichtsstands" einschränkend auszulegen ist. Zum Teil wird davon ausgegangen, dass § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG - wie § 13 Abs. 4 Nr. 1 UWG - nur auf im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangene Verstöße gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten anzuwenden sei (OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2022, 135 Rn. 11 - Mundspülwasser; LG Hamburg Urt. v. 20.04.2023 - 312 O 58/22, GRUR-RS 2023, 20801 Rn. 37; Büscher/Ahrens, UWG, 3. Aufl., § 14 Rn. 43; Büscher, WRP 2025, 273 Rn. 43; Ohly/Sosnitza, UWG, 8. Aufl., § 14 Rn. 29; Teplitzky/Peifer/Leistner/Lerach, UWG, 3. Auflage, § 14 Rn. 164; vgl. auch Wagner/Kefferpütz WRP 2021, 151 Rn. 35 ff.). Andere legen die Vorschrift dahingehend aus, dass § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG nur Fälle einer spezifischen Verletzung von Regelungen erfasse, die sich gerade auf spezialgesetzliche Vorgaben zu Darstellungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien bezögen, also tatbestandlich an ein Handeln im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien anknüpften (LG Düsseldorf GRUR-RR 2021, 333 Rn. 8 ff. - Server fürs ganze Haus; BeckOK HWG/Doepner/Reese, 10. Ed., HWG Einleitung Rn. 382; jurisPK-UWG/Spoenle, 5. Aufl., § 14 UWG Rn. 51). Das Oberlandesgericht Hamburg legt § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG dahingehend aus, dass von der Beschränkung des Wahlrechts aus § 14 Abs. 2 Satz 2 UWG im elektronischen Geschäftsverkehr und in Telemedien jedenfalls diejenigen Fälle ausgenommen sind, in denen nicht von einer besonderen Gefahr des Missbrauchs in Form eines massenhaften Vorgehens auszugehen ist (OLG Hamburg, 07.09.2023, 5 U 65/22, juris Rn. 57 - So geht Positionierung; zuletzt OLG Hamburg, 22.05.2025, 5 W 10/25, juris Rn. 10 ff.). Das Oberlandesgericht Düsseldorf lehnt dagegen eine teleologische Reduzierung des § 14 Abs. Satz 3 Nr. 1 UWG jedenfalls für die Fälle ab, in denen der Verstoß nur in Telemedien erfolgt ist (OLG Düsseldorf, GRUR 2021, 984 Rn. 19 ff. - Internetspezifische Kennzeichnungsvorschriften; so auch MünchKomm-UWG/Ehricke/Könen, 3. Auflage 2022, § 14 Rn. 84; Rüther, WRP 2021, 726 ff.; Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Tolkmitt, UWG, 5. Auflage 2021, § 14 Rn. 85; tendenziell ["dürfte"] auch Köhler/Feddersen, UWG, 43. Aufl., § 14 Rn. 21a).
Auch Vertreter der Ansichten, die eine teleologische Reduktion der Bestimmung weitgehend ablehnen, räumen aber ein, dass der Wortlaut Zweifel aufwirft. Dies gilt insbesondere für die Frage, wie ein Verstoß zu beurteilen ist, der sowohl in Telemedien als auch physischen Medien begangen wird, wie zum Beispiel einheitliche Werbung im Internet und in Zeitschriften (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Tolkmitt, UWG, 5. Auflage 2021, § 14 Rn. 85a; Köhler/Feddersen, UWG, 43. Aufl., § 14 Rn. 21b; Rüther, WRP 2021, 726 Rn. 25 ff. spricht von "Ambiguität"; Teplitzky/Schaub, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 13. Aufl. 2024, Kap. 45 Rn. 20: "stark auslegungsbedürftig"). Für den Fall eines Verstoßes durch Zusendung von E-Mails, obwohl es sich bei diesen um Telemedien handelt, befürwortet auch das Oberlandesgericht Düsseldorf ausdrücklich eine teleologische Reduktion des Tatbestandes (OLG Düsseldorf, WRP 2022, 472 Rn. 9; so auch Köhler/Feddersen, UWG, 43. Aufl., § 14 Rn. 21b). Ferner ist eine Reduktion des Anwendungsbereichs des § 14 Abs. 2 Satz 3 UWG für Fälle im Anwendungsbereich der EuGVVO vorzunehmen, da deren Bestimmungen Vorrang beanspruchen (Teplitzky/Schaub, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 13. Aufl. 2024, Kap. 45 Rn. 20).
Einschränkende Auslegung geboten
Nach Ansicht des Gerichts sei § 14 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG einschränkend auszulegen. Ob diese Einschränkung nur für Fälle gelte, in denen nicht von einer besonderen Gefahr des Missbrauchs in Form eines massenhaften Vorgehens auszugehen ist, oder nur für im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangene Verstöße gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten, musste das Gericht nicht entscheiden. Nach beiden Ansichten finde die Ausnahme nach § 14 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 UWG vorliegend keine Anwendung.
Der Senat schließt sich der Auffassung der Oberlandesgerichte Hamburg und Frankfurt an, wonach der Wortlaut des § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG einer - weitergehenden - einschränkenden Auslegung bedarf. Maßgeblich ist dabei nicht die Gesetzgebungsgeschichte, da die subjektiven Vorstellungen der an der Neufassung der Vorschrift beteiligten Organe der Gesetzgebung unterschiedlich bewertet werden (Büscher/Ahrens, UWG, 3. Aufl., § 14 Rn. 43; Köhler/Feddersen, UWG, 43. Aufl., § 14 Rn. 21a; vgl. auch Teplitzky/Peifer/Leistner/Lerach, UWG, 3. Auflage, § 14 Rn. 163, der von einem "Redaktionsversehen" spricht). Ausschlaggebend ist der objektive Sinn und Zweck der Vorschrift. Dieser besteht darin, dass der Gerichtsstand des Ortes der Zuwiderhandlung im Grundsatz erhalten wird, aber im Bereich der Telemedien eingeschränkt wird, weil allein die Verfolgung dieser Verstöße einer besonderen Missbrauchsanfälligkeit unterliegt. Mittels technischer Mittel ist es möglich, das Internet nach potentiellen Verstößen zu durchsuchen, massenhaft abzumahnen und in der Folge gerichtliche Verfahren einzuleiten. Diese Missbrauchsgefahr realisiert sich vor allem in Fällen, in denen konkrete Vorgaben für die Gestaltung von (Online-)Angeboten bestehen - wie etwa bei den Impressumspflichten - und Verstöße daher ohne größeren Aufwand festgestellt werden können (OLG Hamburg, 7. 9. 2023, 5 U 65/22, juris Rn. 71).
Offen bleiben kann im vorliegenden Fall, ob - wie das Oberlandesgericht Hamburg annimmt - lediglich solche Verstöße der Einschränkung unterfallen, bei denen sich ein solches besonderes Missbrauchspotential feststellen lässt, oder - wie es das Oberlandesgericht Frankfurt annimmt - § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG wie § 13 Abs. 4 Nr. 1 UWG nur auf im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangene Verstöße gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten anzuwenden ist. Die letztgenannte Ansicht hat den Vorteil einer klaren Abgrenzung und praktisch leicht handhabbaren Anwendung der Vorschrift für sich. Dies bedarf hier aber keiner abschließenden Entscheidung, da der vorliegend gerügte Verstoß, der eine Bewertung der angegriffenen Werbeaussage im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt des § 5 UWG erfordert, nach beiden Ansichten nicht unter die Ausnahme des § 14 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UWG fällt. Auch wenn die Antragsgegnerin der Antragstellerin rechtsmissbräuchliches Verhalten vorwirft, begründet sie diesen Vorwurf nicht mit einer massenhaften Vorgehensweise der Antragstellerin.
Fazit
Das OLG Köln nimmt an, dass die Regelung einschränkend auszulegen sei. Ob diese Einschränkung nur für Fälle gilt, in denen nicht von einer besonderen Gefahr des Missbrauchs in Form eines massenhaften Vorgehens auszugehen ist, oder nur für im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien begangene Verstöße gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten, musste das Gericht allerdings nicht entscheiden.
Damit liegt es auf einer Linie mit dem OLG Hamburg, OLG Frankfurt, LG Düsseldorf, LG Frankfurt und dem LG Hamburg. Eine andere Ansicht vertreten hingegen das OLG Düsseldorf und das LG Stuttgart.
.jpg)